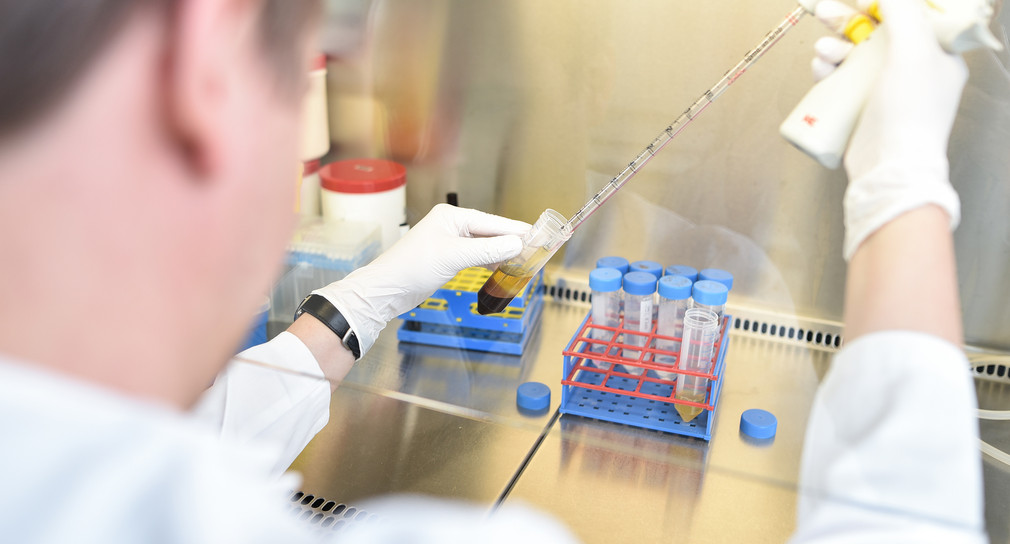
Das Land stellt 2,3 Millionen Euro für die Erforschung von Corona-Komplikationen in verschiedenen medizinischen Einrichtungen bereit. Die Förderung soll den vielen Betroffenen mit langfristigen Corona-Folgen helfen, ihre Genesung durch wissenschaftliche Erkenntnisse besser zu unterstützen.
Das Land Baden-Württemberg fördert die gemeinsame Forschung zu Corona-bedingten Erkrankungen an den Medizinischen Fakultäten und den vier Universitätskliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm mit rund 2,3 Millionen Euro.
„Viele Menschen leiden unter den Langzeitfolgen von COVID-19. Persistierende Müdigkeitssyndrome und neurokognitive Beeinträchtigungen bei zuvor gesunden Erwachsenen scheinen für Patienten nicht nur nach schweren COVID-19-Erkrankungen ein Problem zu sein, sie treten auch nach leichten Verläufen auf“, so der Wissenschaftsminister Theresia Bauer.
Die Entwicklung neuer Erkenntnisse und Therapieansätze sei auch für die Gesellschaft von großer sozioökonomischer Bedeutung, betonte Theresia Bauer. „Daher schätzen und unterstützen wir das Engagement unserer biomedizinischen Standorte, die auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse Therapie- und Beratungsangebote für betroffene Patienten entwickeln wollen.“
Viele betroffene Patienten
Nach aktuellem Stand gelten knapp 94 Prozent und damit mehr als drei Millionen Patienten in Deutschland als von einer COVID-19-Erkrankung genesen. In rund zehn bis 20 Prozent – möglicherweise sogar deutlich mehr – der Fälle treten jedoch anhaltende Symptome noch lange nach der Infektionsphase auf. Dies wird als Post-COVID-19-Syndrom oder Long-COVID bezeichnet. „Die Zahl der Betroffenen ist bisher hoch, und es ist mit einer noch höheren Dunkelziffer zu rechnen“, sagte Theresia Bauer.
Erschöpfungssyndrom und bleibende Organschäden
Diese Langzeitfolgen scheinen nicht nur für Rekonvaleszenzpatienten nach schwerer Krankheit ein Problem zu sein. Sie betreffen auch ehemals Erkrankte ohne die klassischen Risikofaktoren für komplizierte Verläufe, treten nach einem leichten oder mittelschweren Verlauf und ohne stationäre Behandlung der akuten Erkrankung auf und können sogar zuvor (oft unbewusst) Infizierte ohne Symptome überholen. Bekannt geworden ist eine Vielzahl unterschiedlicher Symptome in unterschiedlichen Ausprägungen – bisher rund 50 Symptome. Diese reichen von Müdigkeitssyndromen über neurokognitive Beeinträchtigungen bis hin zu bleibenden Schäden an Organen wie Herz und Lunge oder Nervenbahnen.
Die oft unspezifischen Symptome wie extrem starke Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Atemnot sind individuell unterschiedlich, oft schwer einzuordnen und bestehen über längere Zeiträume (derzeit mindestens sechs Monate). Sie treten auch bei zuvor völlig gesunden Erwachsenen auf, die vor ihrer COVID-19-Erkrankung voll erwerbstätig waren und nun für längere Zeit eingeschränkt oder sogar arbeitsunfähig sind.
Großer Forschungsbedarf
„Seit fast anderthalb Jahren begleitet uns das Virus und wir haben in Sachen Prävention, Diagnose und Therapie schon viel gelernt. Es gilt nun dringend, die Behandlung von Patienten mit Post-COVID-19-Syndrom zu verbessern“, betonte der Wissenschaftsminister. Über dieses Krankheitsbild ist derzeit noch sehr wenig bekannt: Was sind die typischen Leitsymptome? Wie stark sind die Leistungseinschränkungen? Wie ist der Prozess? Lassen sich bei der akuten Erkrankung Hinweise auf drohende Spätfolgen erkennen? Auch gibt es derzeit keine Therapiemöglichkeiten. Dies erfordert umfangreiche wissenschaftliche Daten, die derzeit sehr begrenzt sind und keine medizinisch validierten Langzeitdaten vorweisen können.
Die deutschen Behandlungsleitlinien empfehlen eine Nachuntersuchung stationär behandelter Patienten in der Akutphase nach drei Monaten, ohne therapeutische Konzepte anbieten zu können. Der Forschungsbedarf zu den Langzeitfolgen von COVID-19 ist daher hoch, um möglichst schnell die Grundlage für eine bestmögliche Nachsorge der Patienten zu schaffen.
Beratungs- und Therapieangebote entwickeln
An der Untersuchung sollen zunächst Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren aus ganz Baden-Württemberg teilnehmen, deren COVID-Infektion etwa sechs bis zwölf Monate zurückliegt. Online werden zwei Gruppen von Personen gleichen Alters und Geschlechts aus der gleichen Region rekrutiert: mit und ohne Beschwerden (Kontrollgruppe). Im Ergebnis werden beide Gruppen klinisch und intern in den jeweiligen Nachsorgeambulanzen der Universitätskliniken umfassend untersucht. Eine weitere Nachuntersuchung nach weiteren sechs bis neun Monaten soll Aufschluss über eine mögliche Chronifizierung geben, indem die leistungs- und arbeitsfähigkeitsrelevante Dynamik der Beschwerden untersucht wird.
Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen soll ein Beratungs- und Therapieangebot zur interdisziplinären Behandlung aller Patienten mit persistierenden Post-COVID-19-Beschwerden entwickelt werden. Derzeit gibt es in Deutschland nur sehr wenige Nachsorgeambulanzen, die Patienten nach einer akuten Erkrankung in den ersten Wellen systematisch nachsorgen.
Weitere Informationen zum Coronavirus in Baden-Württemberg
Mit unserer Messenger-Dienst Sie erhalten alle Änderungen und wichtige Informationen immer aktuell als Push-Nachricht auf Ihr Handy.
.
Inspiriert von Landesregierung BW



