Silbermünzen aus Kloster Kaltenborn: Zeugen aus stürmischen Zeiten!
Silbermünzen des Klosters Kaltenborn werden ab 28. Juni im Landesmuseum Halle präsentiert. Die Ausstellung beleuchtet klösterliche Geschichte.

Silbermünzen aus Kloster Kaltenborn: Zeugen aus stürmischen Zeiten!
Am 9. Juni 2025 wird das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale) eine bedeutende Ausstellung eröffnen, die sich mit der Rolle des ehemaligen Klosters Kaltenborn bei Allstedt beschäftigt. Ab dem 28. Juni sind dort Silbermünzen zu sehen, die aus diesem Kloster stammen. Diese Münzfunde sind Teil der Kabinettsausstellung „Klöster. Geplündert. In den Wirren der Bauernaufstände“, die bis zum 30. November 2025 läuft. Die Ausstellung ist Teil der dezentralen Landesausstellung „Gerechtigkeit 1525“, die von der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) sowie dem Land Sachsen-Anhalt gefördert wird. Laut Zeit beschrieb Landesarchäologe Harald Meller die Funde als wichtige Zeugen der Klostergeschichte und geben einen Einblick in den Alltag der monastischen Gemeinschaft.
Die Münzen, die in der Ausstellung zu sehen sein werden, umfassen Hohlpfennige, Pfennige und Groschen, die zwischen 1190 und 1513 im mitteldeutschen Raum geprägt wurden. Ihre Herkunft reicht von Naumburg über Saalfeld bis hin zu Böhmen und Nürnberg. Verwendet wurden sie für verschiedene Zwecke, etwa zur Bezahlung von Lohnarbeitern sowie für Einkäufe auf lokalen Märkten, was die wirtschaftliche Bedeutung des Klosters unterstreicht. Darüber hinaus konnten Archäologen bei Ausgrabungen in Kaltenborn auch Rechenpfennige aus Kupfer finden, die im Mittelalter als Hilfsmittel zur Buchhaltung genutzt wurden.
Das Kloster Kaltenborn im historischen Kontext
Das Kloster Kaltenborn wurde bereits 1118 gegründet und entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem wohlhabenden Zentrum mit großen Ländereien, darunter Weinberge, Wälder und Mühlen, die sich zwischen dem Ostharz und dem südlichen Thüringen erstreckten. Historische Quellen belegen, dass das Kloster von den Augustinerchorherren bis ins 16. Jahrhundert ein bedeutendes religiöses und wirtschaftliches Zentrum war. Die dreischiffige Basilika wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichtet und in späteren Jahren gotisch ausgebaut, bevor sie im Bauernkrieg 1525 zerstört wurde. Archäologen haben in jüngster Zeit große Teile der Klosterkirche freigelegt, die unter Schuttmassen teilweise bis zu zwei Meter hoch erhalten geblieben sind, wie das MDR berichtet.
Die Ausgrabungen haben reichhaltige Kleinfunde zutage gefördert, darunter Münzen, Buchbeschläge, Gürtelschnallen und Schmuckstücke, die auf den Wohlstand des Klosters während seiner Blütezeit hinweisen. Doch bereits im 15. Jahrhundert gab es erste Anzeichen von Unmut in der Bevölkerung. Während des Bauernaufstandes 1525 plünderten Aufständische aus nahegelegenen Dörfern die Klosteranlage. Die gesellschaftlichen Spannungen hatten sich zuvor aufgebaut, was schließlich zur Zerstörung des Klosters führte. Bereits im April 1525 berichteten Zeitzeugen von Plünderungen und Verwüstungen, die viele Angehörige des Klosters zur Flucht zwangen. Das Kloster wurde 1538 schließlich aufgelöst.
Die bevorstehende Ausstellung im Landesmuseum bietet somit nicht nur einen Einblick in die materiellen Hinterlassenschaften des Klosters Kaltenborn, sondern auch in die komplexen sozialen Dynamiken und Spannungen, die zur Zerstörung dieser bedeutenden Institution führten. Die Münzen und anderen Funde verdeutlichen die wirtschaftlichen Aspekte des Klosterlebens sowie die Herausforderungen, mit denen die monastische Gemeinschaft konfrontiert war.
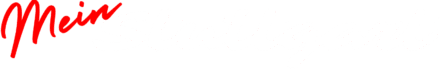
 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto
