Hochwasserschäden in Bayern: Über 60 Millionen Euro ausgezahlt!
Münster informiert über die Hochwasserschäden in Süddeutschland 2024, aktuelle Hilfsmaßnahmen und die Diskussion zur Pflichtversicherung.

Hochwasserschäden in Bayern: Über 60 Millionen Euro ausgezahlt!
Ein Jahr nach den verheerenden Hochwasserereignissen in Süddeutschland, die besonders Bayern und Baden-Württemberg betroffen haben, zeigt sich, wie gravierend die Auswirkungen solcher Naturkatastrophen sind. Laut Antennen Münster hat die bayerische Staatsregierung mittlerweile über 60 Millionen Euro an Geschädigte ausgezahlt und plant ein umfangreiches Soforthilfeprogramm, das bis zu 200 Millionen Euro umfassen könnte. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Schäden bei Privatpersonen, Gewerbebetrieben und Landwirten auszugleichen, insbesondere auch bei denen, die nicht versichert sind.
Die schweren Überflutungen, die Ende Mai und Anfang Juni 2024 auftraten, forderten tragischerweise auch Menschenleben und hinterließen in beiden Bundesländern Schäden in Höhe von geschätzten 4,1 Milliarden Euro. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) schätzt dabei die versicherten Schäden auf lediglich zwei Milliarden Euro. Die Situation ist besorgniserregend, da das Juni-Hochwasser 2024 als eines der schwersten Hochwasserereignisse in den letzten Jahren gilt und schwerwiegende fiskalische und gesellschaftliche Folgewirkungen hat.
Investitionen in den Hochwasserschutz
Die bayerische Regierung ist sich der Notwendigkeit bewusst, in den Hochwasserschutz zu investieren. Seit 2001 wurden etwa vier Milliarden Euro in Schutzmaßnahmen investiert. Geplant sind zusätzliche Investitionen in Milliardenhöhe bis 2030, um die Infrastruktur zu verbessern. Dazu gehören der Bau von über 190 Kilometern Deichen, 70 Kilometer Hochwasserschutzwänden sowie die Sanierung von 340 Kilometern Dämmen. Trotz dieser Bemühungen werden die Herausforderungen in der Hochwasserlage in Deutschland, die sich vor allem in den betroffenen Bundesländern weiter verschärft, nicht geringer.
Das Tagesschau berichtet, dass die Schäden durch Hochwasser enorm sind: Deiche reißen, Häuser müssen evakuiert werden und der Druck auf die Verantwortlichen wächst. Obwohl das „Nationale Hochwasserschutzprogramm“ vor über zehn Jahren ins Leben gerufen wurde, liegen bisher nur 15 Prozent der vorgesehenen Projekte in der Bauphase. Maßnahmen, die für den Hochwasserschutz von entscheidender Bedeutung sind, sind oft noch in der Planungs- oder Konzeptionsphase.
Diskussion um Pflichtversicherungen
Inmitten dieser ernsten Herausforderungen wird eine Diskussion über die Einführung einer Pflichtversicherung gegen Hochwasserschäden angestoßen. In Deutschland ist nur etwa jedes zweite Gebäude gegen Elementarschäden versichert, in Baden-Württemberg liegt der Anteil jedoch bei 94 Prozent. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und andere Länderchefs unterstützen die Forderung nach einer Pflichtpolice, während Stimmen wie die des FDP-Generalsekretärs Bijan Djir-Sarai vor den potenziellen Preissteigerungen für Eigentümer warnen. Eine Arbeitsgruppe soll dazu Empfehlungen abgeben, während ein bevorstehendes Treffen im Kanzleramt zwischen Bundeskanzler Scholz und den Länderchefs die Debatte weiter vorantreiben könnte.
Die Notwendigkeit zur Anpassung an die Klimakrise und die damit verbundenen wetterbedingten Extremereignisse wie Starkregen und Überflutungen wird immer deutlicher. Das BMUV hebt hervor, dass ein neues bundesweites Klimaanpassungsgesetz (KAnG) Ende 2023 verabschiedet wurde, das am 1. Juli 2024 in Kraft trat. Dieses Gesetz legt einen strategischen Rahmen für die Klimaanpassung fest und verpflichtet die Länder, eigene Konzepte in Kommunen und Kreisen zu erarbeiten. Die Bundesregierung hat zudem die Aufgabe, eine umfassende Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen zu entwickeln.
Die Diskussion über Hochwasserschutz und den Umgang mit den Folgen der Klimakrise wird in den kommenden Monaten von zentraler Bedeutung sein, um den betroffenen Regionen und deren Bürgern die notwendige Sicherheit zu bieten.
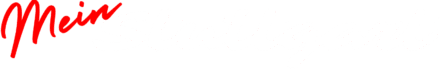
 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto
